Sie ist schon längst da: Die Künstliche Intelligenz hat in der Medizin Einzug gehalten und wird immer weiterentwickelt. Dabei ist Augenmaß gefragt. Nicht alles, was technisch möglich ist, wird tatsächlich umgesetzt. Warum das sinnvoll ist und was schon alles gemacht wird, zeigt unser Gespräch mit dem Soziologen und Gesundheitswissenschaftler Dr. Christoph Karlheim, Leiter der Stabsstelle „Innovation und Forschung“ beim EvKB und der Ärztin Laura Moreno, Referentin der Geschäftsführung.
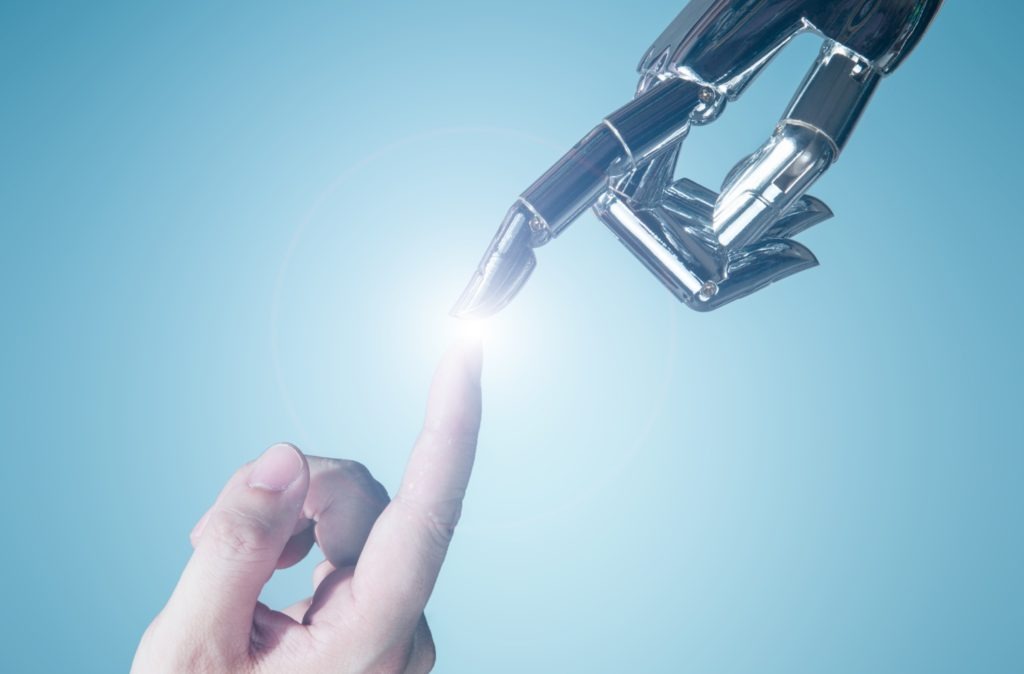
Laura Moreno: Bei uns im Haus ist das Thema Digitalisierung eine klassische Querschnittsaufgabe und damit Chefsache. Wir haben das große Glück, dass beide Geschäftsführer auch Ärzte sind und damit aus der Praxis kommen. Sie wissen aus eigener Erfahrung, wie der Klinikalltag funktioniert und sind gleichzeitig intensiv mit der Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie im Hause befasst. In allem, was wir tun, denken wir digital. Wir müssen zum Beispiel bei der Planung eines neuen Gebäudes, wie gerade aktuell bei der Gerontopsychiatrie, digital assistive Technologien und die Vernetzung mit Medizintechnik berücksichtigen. Das fängt – so banal es klingt – bei den Netzdosen an. Wir möchten Grundlagen für eine umfassende digitale Transformation schaffen, Strukturen vordenken und zugleich Akzente setzen. Dabei müssen wir agil bleiben und nicht nur darauf schauen, was in der Technologie passiert, sondern auch im Blick behalten, was vom Gesetzgeber in puncto Datenstandards vorgegeben wird.
Christoph Karlheim: Dass es in einem Versorgungskrankenhaus eine Stabsstelle für „Innovation und Forschung“ gibt, ist etwas Besonderes. Mit Blick auf die Gründung der medizinischen Fakultät an der Universität Bielefeld und unserer Beteiligung als Teil des neuen Universitätsklinikums OWL ist das von Vorteil. Somit haben wir schon jetzt einen guten Überblick über Ausschreibungen von Bund oder Land in der Forschung und können uns daran beteiligen. Wir pflegen seit Jahren Kooperationen unter anderem mit der Universität und der FH Bielefeld, der Fachhochschule der Diakonie in Bethel sowie anderen Forschungseinrichtungen. Vor einigen Monaten ist bei uns noch der Bereich „Auftragsforschung“ zum Aufgabenprofil der Stabstelle hinzugekommen.
Laura Moreno: Eines vorweg: Die Technik soll den Menschen nicht ersetzen, sondern sinnvoll unterstützen. So dient die Digitalisierung der Patientendaten vor allem der Patientensicherheit. Diese Daten sind für alle an der Behandlung Beteiligten einsehbar. Von der Aufnahme bis zur Entlassung.Beim digitalisierten Arzneitherapieplan können z. B. unerwünschte Wechselwirkungen von Medikamenten ausgeschlossen werden, wenn das System Alarm schlägt.
Christoph Karlheim: Der Übergang von der stationären zur ambulanten Weiterbehandlung wird durch assistive Systeme verbessert. Glücklicherweise sehen mittlerweile die Krankenkassen den Mehrwert und übernehmen in Teilen die Kosten dafür. Genauso wie für die Videosprechstunde. In der Psychiatrie hier bei uns im EvKB setzen wir in diesem Kontext mit „Radius“ ein webbasiertes Programm ein, das alkoholabhängigen Menschen nach der Entgiftung hilft, abstinent zu bleiben. Darüber können ein Tagebuch geführt, emotionale Kurven eingetragen und Kontakt zum Therapeuten aufgenommen werden. Es ist deutlich einfacher, nachts um 3 Uhr eine Nachricht zu schreiben als den Therapeuten anzurufen. Die Barriere wäre zu hoch. „Radius“ ist ein gutes Beispiel für eine sinnvolle Verbindung von digitaler und analoger Versorgungspraxis.
„Wir wollen nicht erforschen, was möglich ist, sondern das, was nützlich ist.“
Dr. Christoph Karlheim
Laura Moreno: Im Bereich der Robotik sind wir breit aufgestellt. Fast schon berühmt ist in der Urologie unser „DaVinci“-Roboter, mit dem wir bei seiner Einführung bundesweit zu den Vorreitern gehörten. In unserem Hause nutzen auch die Bauchchirurgen den Roboter für komplexe Operationen. In der Neurochirurgie ist das sogenannte Mapping als Technik zum Aufspüren der Lage eines Funktionszentrums ein enormer Fortschritt. Damit wird die Planung einer OP vereinfacht. Denn durch das Mapping wird eine Art Landkarte des Gehirns sichtbar. Vor dem eigentlichen Eingriff können Areale stimuliert werden, um zu prüfen, welcher Hirnbereich wie reagiert. Dadurch kann man jetzt im Gehirn noch präziser operieren, ein Bereich, in dem der Operateur keinen Millimeter danebenliegen darf. Das ist auch besonders für die Chirurgie von Hirntumoren ein unschätzbarer Gewinn.
Laura Moreno: Gerade bei den bildgebenden Verfahren hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Bei der MRT zur Darstellung von Struktur und Funktion der Gewebe und Organe im Körper ist sehr viel mehr Software im Einsatz. Bei den Radiologen hat sich der Datentransfer enorm beschleunigt, so dass Röntgenbilder zur Befundung viel schneller verfügbar sind. Insgesamt sind die Bilder klarer und schärfer. Das ermöglicht den Ärzten eine bessere Beurteilung. Außerdem können Algorithmen Standardbilder erzeugen, die als Vergleich über das Röntgenbild des Patienten gelegt werden können. Aber zur Beurteilung braucht man auf jeden Fall den Spezialisten. Das kann man keiner Maschine überlassen. Für junge Ärzte in der Ausbildung können assistive Technologien eine gute Ergänzung sein. Ich denke, dass KI in Zukunft bei der Ausbildung von Medizinern eine große Rolle spielen wird.
ZUKUNFTSMUSIK
Ein virtueller Assistent, der hilft, den Tag zu organisieren; eine Brille, die bei Tätigkeiten im Haushalt Tipps gibt, wenn einem nicht mehr einfällt, wie es weitergeht; eine Wohnung, die im Notfall den Pflegedienst oder die Ärztin alarmiert – dies sind mögliche Szenarien für den Einsatz assistiver Technologien. Um diese Unterstützungssysteme zu entwickeln und zu erproben, kooperieren der Exzellenzcluster Kognitive Interaktionstechnologie (CITEC) der Universität Bielefeld und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel seit 2011. CITEC hat sich als Forschungseinrichtung auf technische Systeme wie Roboter und Avatare spezialisiert, die sich auf den Menschen einstellen und intuitiv bedienbar sind. In ihren gemeinsamen Projekten entwickeln CITEC und Bethel Technik, die hilft, ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen – insbesondere bei chronischer Krankheit, Behinderung oder im Alter. Die neuen Systeme sollen die Nutzerinnen und Nutzer in ihrer selbstständigen Lebensführung unterstützen, aber auch in der Lage sein, Unterstützung anzufordern. Sie sind „persönliche“ Assistenten und folgen den Anweisungen von Menschen, statt selbst vorzugeben, was zu tun ist. Der Clou: Die assistiven Technologien kennen die Gewohnheiten und Vorlieben ihrer Nutzerinnen und Nutzer, lernen dazu und reagieren individuell. Ein Grundgedanke der Kooperation ist, dass die Technik den Menschen nicht „verordnet“ wird. Vielmehr sollen sich die Ideen der Forschungseinrichtung CITEC an praktischen Bedürfnissen messen. Umgesetzt wird nur das, was sozial akzeptiert wird: Welche neue Technik wollen und können die Nutzerinnen und Nutzer in ihren Alltag übernehmen? Dabei geht es einerseits um die Menschen, die in den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel begleitet werden und ihre Angehörigen. Andererseits geht es um die Mitarbeiter in Bethel, die mit neuen technischen Möglichkeiten entlastet werden sollen.

In allem, was wir tun, denken wir digital.
Laura Moreno
Christoph Karlheim: Wir müssen aufpassen, dass wir alle Menschen mitnehmen und nicht bestimmte Gruppen, wie beispielsweise Menschen mit Behinderungen oder Menschen mit Migrationshintergrund, ausschließen. Außerdem muss dafür gesorgt werden, dass Menschen frühzeitig lernen, mit der Informationsflut über Krankheiten im Netz umzugehen. Denn wer Dr. Google befragt, fährt unter Umständen ganz unnötig in die Notaufnahme. Es ist wichtig, seriöse von unseriösen Quellen im Netz unterscheiden zu können. Beim Einsatz von assistiven Technologien müssen unterschiedliche Perspektiven – die der Betroffenen, der Angehörigen aber auch der professionellen Akteure – berücksichtigt werden.
Christoph Karlheim: Für ein großangelegtes Projekt, das vom Land NRW gefördert wird und in Kooperation mit der Uni Bielefeld durchgeführt wird, erforschen wir derzeit technische Möglichkeiten zur Unterstützung von Menschen mit einer Demenz und deren Angehörige im häuslichen Umfeld. Dazu befragen wir sie, wie ihr Bedarf und ihre Bedürfnisse aussehen, aber auch wo sie Ängste haben oder Hürden in der Anwendung sehen. Das kann sehr unterschiedlich sein. Für die Angehörigen kann es beruhigend sein, dass sie durch einen Tracker jederzeit wissen, wo sich der an Demenz Erkrankte gerade befindet. Der Mensch selbst kann es als Eingriff in seine Autonomie und als Bevormundung empfinden. Einige Befragte fanden die Vorstellung, sich vor einem Roboter umzukleiden, fürchterlich. Deshalb sehen Roboter übrigens so aus, wie sie heute aussehen. Sind Aussehen und Stimme zu menschlich, ist die Akzeptanz geringer. Ich bin sehr froh, dass wir bei diesem Projekt den Nutzer in den Vordergrund stellen, das wird häufig zu wenig gemacht, vor allem dann nicht, wenn ein wirtschaftliches Primat im Vordergrund steht. ‚Anything goes‘ kann nicht der Ansatz sein. Wir wollen in Bethel nicht erforschen, was möglich ist, sondern das, was nützlich ist.
Christoph Karlheim: Grundsätzlich stellt sich die Frage, wer wann und wie mit den Daten arbeiten darf. Ist die Anonymisierung der Daten gewährleistet und wird sie der freien Forschung zu Verfügung gestellt, dann wäre das ein Gewinn. Dazu ist wahrscheinlich ein größeres Datenschutzpaket notwendig. Bei den Gesundheits-Apps ist der Markt momentan groß und unübersichtlich. Bei vielen Apps ist nicht klar, welche Zielsetzungen und Ideen hinter den Apps stehen. Denn Wirtschaftsunternehmen wie zum Beispiel Amazon und Google folgen einer anderen Logik als Mediziner und Wissenschaftler. Bei den Unmengen von Apps könnte es für den Hausarzt schwierig werden, eine Auswahl zu treffen, welche App für seinen Patienten sinnvoll und sicher ist.
DAVINCI – DER ROBOTER IM OP
Die Kliniken für Urologie und Allgemein- und Viszeralchirurgie im EvKB stehen für eine computerassistierte und robotische Chirurgie. Grundlage ist die Operationstechnik mit dem DaVinci-Roboter, die eine präzise Übertragung der Hand- und Fingerbewegungen des Operateurs auf die Instrumente ermöglicht. Das heißt, der Roboter vermag Handbewegungen auszuführen, die uns Menschen aufgrund unserer Anatomie nicht möglich sind. Die außergewöhnliche Feinheit und Beweglichkeit der Operationsinstrumente eröffnet neue Möglichkeiten der minimal-invasiven Chirurgie. Dadurch ist der Chirurg nicht nur in der Lage, auch feinste Strukturen wie Nervenbündel oder kleinere Gefäße sicher zu identifizieren, sondern kann ebenso exakt, gewebeschonend und mit minimalem Blutverlust operieren. Dem Operateur, der den Roboter steuert, steht eine dreidimensionale Sichtweise mit der Möglichkeit der stufenlosen Vergrößerung zur Verfügung. Außerdem ist der Roboter so an den OP-Tisch gekoppelt, dass der intelligente Tisch sich bewegt, wie es gerade für den Operationsvorgang sinnvoll ist. Der Patient muss demnach nicht mehr per Hand umgelagert werden.








