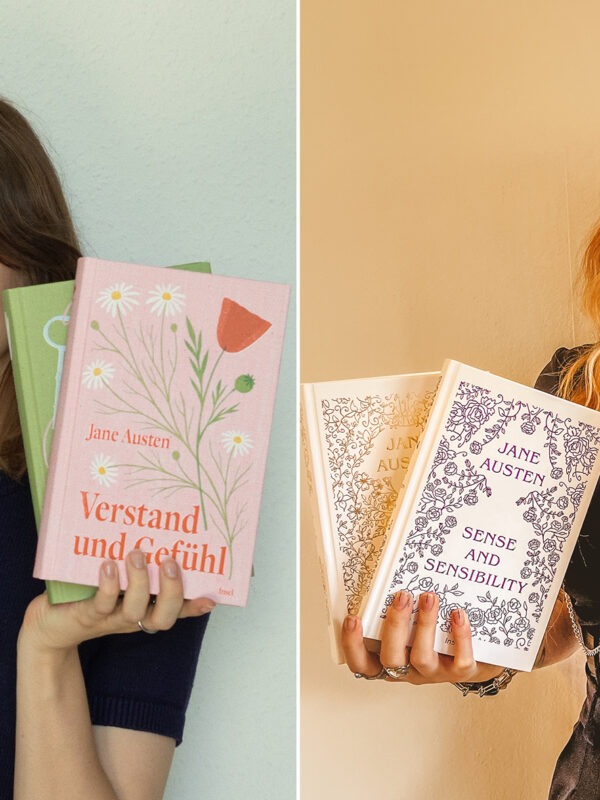Wie soll die Kita von morgen aussehen? Welche Themen brennen Fachkräften, Eltern und Trägern unter den Nägeln? Beim Makerthon „Kita neu denken“ der Hochschule Bielefeld haben jetzt 30 Studierende der HSBI und der Universität Bielefeld innerhalb von drei Tagen konkrete Ideen für die Zukunft des Kita-Alltags entwickelt.
Helen Knauf und Milena Förster (v.l.)
„Die Kindheit prägt den Lebensweg entscheidend, und frühkindliche Bildung ist der Schlüssel“, betont Prof. Dr. phil. Helen Knauf, die das Format gemeinsam mit Milena Förster leitete.
Das Besondere am Makerthon: Studierende der Kindheitspädagogik bzw. der Erziehungswissenschaft arbeiteten direkt mit Leitungskräften, Trägern und Fachkräften zusammen. Unterstützt wurden sie von Innovationsmanager*innen des ThinkTanks OWL, die das kreative Format begleiteten. Zum Abschluss präsentierten die Teams ihre Ideen in kurzen „Pitches“ vor einer Jury. „Es ist ein Format, was man eher aus den Bereichen Informatik oder Wirtschaft kennt. Unser Ziel ist es jedoch, Hochschule mit der Praxis zu vernetzen und neue Formate auszuprobieren, um die pädagogische Qualität in Kitas zu verbessern – mit einem differenzierten wie wertschätzenden Blick auf Eltern und Kinder“, erklärt Helen Knauf. Für die Studierenden bot der Makerthon wiederum die Chance, neben frischen Konzepten auch Kontakte zu knüpfen, die für die spätere Berufspraxis wertvoll sind.
Die Bilanz kann sich sehen lassen: Von digitalen Tools über pädagogische Konzepte bis zu ganz handfesten Ideen reichte die Palette. „Durch Methoden und Haltung lässt sich vieles verändern“, sagt Helen Knauf. Der Transfer in die Praxis ist für sie eine klare Aufgabe. Das Bewusstsein für Bildungssituationen im Kita-Alltag zu schärfen, ein Anliegen. „Kinder benötigen gar nicht so viele Angebote, es geht vielmehr um die richtigen Impulse“, unterstreicht auch Milena Förster, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Helen Knauf und Milena Förster haben eine klare Vorstellung von der Kita der Zukunft. Sie soll vielfältiger werden – sowohl in Bezug auf Familienkulturen als auch in den Lernangeboten.
„Die Kinder kommen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen, die Familien sind diverser und internationaler. Auf beiden Seiten muss Vielfalt wachsen“, so die Professorin des Fachbereichs Sozialwesen der HSBI, deren Lehrgebiet Bildung und Sozialisation im Kindesalter umspannt.

Assistenzkräfte könnten künftig helfen, Barrieren abzubauen und individuelle Förderung – etwa Sprach- oder Ergotherapie – selbstverständlich in den Alltag zu integrieren. „Es braucht individualisierte Bildungsangebote und eine diverse Bildungsarbeit für unterschiedliche Lernvoraussetzungen“, betont Helen Knauf.
Auch die Vernetzung steht weit oben auf der Agenda. Nicht nur digital, sondern auch physisch gedacht. Das kann zum Beispiel ein Kita-Besuch beim Bäcker um die Ecke sein oder der Kontakt zu umliegenden Schulen oder Seniorenheimen. Aber auch digitale Plattformen, die Eltern, Vereine, Kinderärzt*innen und Therapeut*innen zusammenbringen, sollen künftig mitgedacht werden. „Unsere Studierenden haben ein Konzept entwickelt, mit dem passende Hilfen schneller gefunden werden können“, erklärt Milena Förster.
Ein weiterer Schwerpunkt: der Bildungsauftrag. „Ist der Kita-Alltag ganzheitlich gestaltet, deckt er viele Interessen der Kinder ab, die unterschiedliche Bildungsbereiche erleben und erproben, und ist zugleich bildungsorientiert“, erklärt Milena Förster. Schon beim Backen können Kinder zählen, Mengen abwiegen oder chemische Prozesse entdecken – ganz ohne „Extra-Angebot“. Jedes Kind nimmt aus diesen Aktivitäten etwas anderes mit, die Aufgabe der Fachkräfte liegt darin, dies sensibel zu begleiten.

„Optimale Bildungsmöglichkeiten orientieren sich an den Bedürfnissen der Kinder“, macht Helen Knauf deutlich. Die Digitalisierung kann dabei ein wichtiger Baustein für gute Bildungsarbeit sein und Fachkräfte zusätzlich entlasten. Ein Team entwickelte ein KI-Handbuch, das mit gezielten Prompts hilft, pädagogische Angebote zu planen und Dokumentationsaufwand zu reduzieren.
„So bleibt mehr Zeit für die Kinder“, erklärt Helen Knauf. Daneben entstand die Idee einer Wanddokumentation: Fotos, Rezepte und Co. machen Lernprozesse für Eltern sichtbar und zeigen, wie Bildung und Alltag ineinanderfließen. „Die Kita-Arbeit wird künftig projektlastiger und partizipativer“, erklärt Helen Knauf.
Doch trotz aller Technik bleibt eines zentral: Beziehung. „Kinder brauchen Menschen, die auf sie eingehen, sie begleiten und ernst nehmen. Das ist die Grundlagefür qualitätsvolle pädagogische Arbeit“, so Helen Knauf. Roboter, die beim Aufräumen helfen oder als Impuls- und Ideengeber für Fachkräfte dienen, kann sie sich durchaus vorstellen – „aber niemals als Beziehungsersatz“.
Wichtig ist beiden Expertinnen auch, Kindern Selbstbestimmung zu ermöglichen. Offene Lernwerkstätten und altersgemischte Gruppen fördern die Entscheidungsfähigkeit. „Kita ist zwar keine Familie, aber das Gefühl der Geborgenheit entspringt aus der Gruppe selbst heraus“, betonen Helen Knauf und Milena Förster. „Das ist ein wichtiger Baustein, um ein erfülltes Leben führen zu können.“