Entfernen wir uns voneinander?
Abstand halten – eine der wichtigsten Regeln im Umgang mit der Corona-Pandemie. Was aber macht die Distanz mit uns? Ein Interview mit Prof. Dr. Melanie Jonas, Dozentin für Psychologie an der Fachhochschule des Mittelstands (FHM).
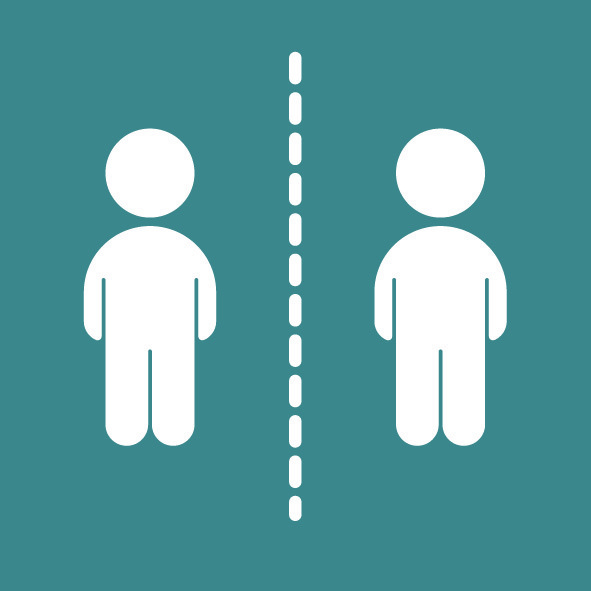

Studien haben gezeigt, dass der Mensch pro Tag zehn bedeutungsvolle Berührungen braucht, um sich psychisch wohlzufühlen. Bei Körperkontakt wird das im Gehirn produzierte Hormon Oxytocin, das „Kuschelhormon“, ausgeschüttet. Mit Berührungen sind nicht in erster Linie sexuelle Kontakte gemeint, sondern auch, sich an den Händen zu halten oder sich zu umarmen. Ganz wichtig ist der Körperkontakt für die Entwicklung von Kindern. Beispielsweise Waisenkinder erfahren manchmal nicht die körperliche Zuwendung, die Kindern in Familienverbänden zukommt.
Tendenziell sind Menschen, die mit anderen Menschen zusammenleben, sei es in einem Familienverband, in einer WG oder mit Freunden etwas besser dran, weil der Entzug der sozialen Kontakte, wie beim Lockdown im März und April, nicht so extrem war. Schwierig war es für Singles, Menschen mit einer Fernbeziehung, ältere Menschen, die als Risikogruppe keinen Besuch hatten und für Menschen mit Behinderungen in entsprechenden Einrichtungen. Für Menschen mit psychischen Erkrankungen konnte eine Therapie zeitweise nicht oder nur virtuell stattfi nden. Und natürlich für alle, die sich in Quarantäne befanden beziehungsweise befi nden. Vorläufige Untersuchungen deuten darauf hin, dass Menschen, die sich zuvor schon einsam gefühlt haben, nun ein größeres Risiko haben, sich schlecht zu fühlen. Dabei gilt zu unterscheiden: Nicht jeder, der allein lebt, fühlt sich auch tatsächlich einsam.
Wir müssen Kompromisse machen. Wie zum Beispiel den Ellbogen-Check zur Begrüßung anstelle des Handschlags. Eine mediale Kommunikation mittels Facetime oder Videokonferenzen kann den Mangel ein wenig ausgleichen. Laborstudien haben gezeigt, dass bei Probanden, die Videos mit sozialen Interaktionen sehen, Hirnregionen angetriggert werden, die auch beim realen Kontakt aktiv werden würden. Allerdings kann auch das subjektive Einsamkeitsempfinden nach Abschalten einer Videokonferenz, wenn man dann wieder allein im Homeoffice sitzt, zunehmen. Videokonferenzen sind aber auch anstrengend. Manchmal fällt man sich durch eine technisch bedingte zeitliche Verzögerung gegenseitig ins Wort, auch wenn man das gar nicht will.
„Distanz ist nicht nur räumlich.“
Das ist richtig. Dabei steht die Wissenschaft erst am Anfang. Für uns alle fühlt es sich an, als wären wir schon eine Ewigkeit mit Corona befasst, für die Forschenden ist es erst der Anfang. Eine neue Situation ist es auch, dass die Wissenschaft viel mehr als sonst im Lichte der Öff entlichkeit steht. Besonders wenn ich an die Virologen denke, von denen schnelle Ergebnisse gefordert werden – und das beinahe täglich. Wenn sie neue Erkenntnisse veröff entlichen, die zum Teil vorherigen widersprachen, sah es so aus, als hätten die Forschenden ihre Meinung geändert. Dabei handelte es sich meist jedoch um neue Ergebnisse, die auch andere Interpretationen zulassen. Wissenschaft braucht Zeit, um sich sorgfältig mit Problemlagen auseinanderzusetzen. Erste Erkenntnisse meiner Kollegen der FHM Hannover, die eine repräsentative Befragung zu psychischen Beschwerden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie durchführen, legen nahe, dass die Folgen erst noch kommen werden. Bei Kindern und Jugendlichen zeigen sich jetzt häufiger schon Probleme, darauf deuten Ergebnisse einer aktuellen Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf hin.

Für Kinder und Jugendliche ist es häufig schwieriger, die Situation, in der wir uns befinden, einzuordnen oder zu kompensieren. Schulen und Kindergärten waren geschlossen, Treff en mit Freunden eine Weile nicht möglich. Ich habe das an meinem eigenen Sohn auch feststellen können, ohne KiTa-Besuch war er deutlich gereizter. Für Einzelkinder ist es schwierig, wenn die Kontakte außerhalb des Familienverbandes weggefallen, aber auch für sehr große Familien, wo es räumlich vielleicht keine Rückzugsmöglichkeiten gibt. Auch wenn ältere Kinder und Jugendliche häufig mittels sozialer Medien kommunizieren, echte Treffen sind nach wie vor wichtig.
Ich glaube, dass wir uns mittlerweile ganz gut damit arrangiert haben. Normalerweise ist die Mimik für uns wichtig, um unseren Gegenüber und die gesamte Situation einordnen zu können. Ist der Gesichtsausdruck nicht zu sehen, kann es zu Missverständnissen kommen. Unser soziales Hirn schreit förmlich nach Informationen. Die Masken erschweren das, aber andere visuelle Signale, wie Gestik, Körpersprache oder die Augen, bleiben uns. Deshalb ist direkte Kommunikation so wichtig. Wenn ich mich zum Beispiel im Bus auf einen freigewordenen Platz weiter nach hinten setze und mich damit von jemandem wegsetze, wäre es gut, dass direkt anzusprechen. Distanz ist nicht nur räumlich. Wenn ich jemandem im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Weg gehe, signalisiere ich ihm, dass ich nichts mit ihm zu tun haben will. Momentan fallen vielfach Gespräche mit fremden Menschen fast ganz weg, wenn ich beispielsweise an die Pendler im öffentlichen Nahverkehr denke.
Leider ja. In Stresssituationen suchen Menschen den Kontakt zu anderen, um Stress abzubauen. Für viele ist die Corona-Pandemie aus verschiedenen Gründen eine belastende Situation. Viele Menschen haben ihre Arbeit verloren oder eine Weile gar nicht gearbeitet. Andere arbeiten mehr als vorher. Daher ist es empfehlenswert, jegliche Formen der Kommunikation zu nutzen und sich eine Tagesstruktur zu geben.



